Praxisfelder

Medizin
Die weitverbreitete Kritik am Gesprächsverhalten von Ärzt*innen und eine gesellschaftliche Erwartung an einer weniger hierarchischen Arzt-Patienten-Beziehung haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass bspw. Kommunikationstrainings fester Bestandteil in den Curricula medizinischer Fakultäten geworden sind oder auch vermehrt Leitlinien zur „guten“ ärztlichen Kommunikation herausgegeben wurden (z.B. Ärztekammer Nordrhein). Zugleich gibt es jedoch bislang keinerlei empirische Hinweise, dass diese Maßnahmen tatsächlich auch einen nachhaltigen Einfluss auf das kommunikative Handeln von Ärzt*innen haben.
Der Fokus auf einfach zu vermittelnde und insbesondere unkompliziert zu testende „Techniken“ der Kommunikation (die überdies zumeist aus anderen Fachdisziplinen an die Medizin herangetragen werden) reduziert dabei die Interaktion von Ärzt*innen mit Patient*innen, Angehörigen oder auch mit anderen Professionen auf ein Set von diskreten Verhaltensweisen, deren Sinn und Nutzen im Hinblick auf die Entwicklung allgemeiner fachlicher Expertise von (angehenden) Ärzt*innen oft nicht (an-)erkannt wird, und bei dem spätestens im Übergang ins Praktische Jahr oder die Facharztweiterbildung von vorgesetzten Ärzt*innen – mehr oder minder implizit – vermittelt wird, dass im ärztlichen Alltag „eigentlich“ ganz andere Dinge wichtig sind im Umgang mit Patient*innen (Somm und Hajart 2015).
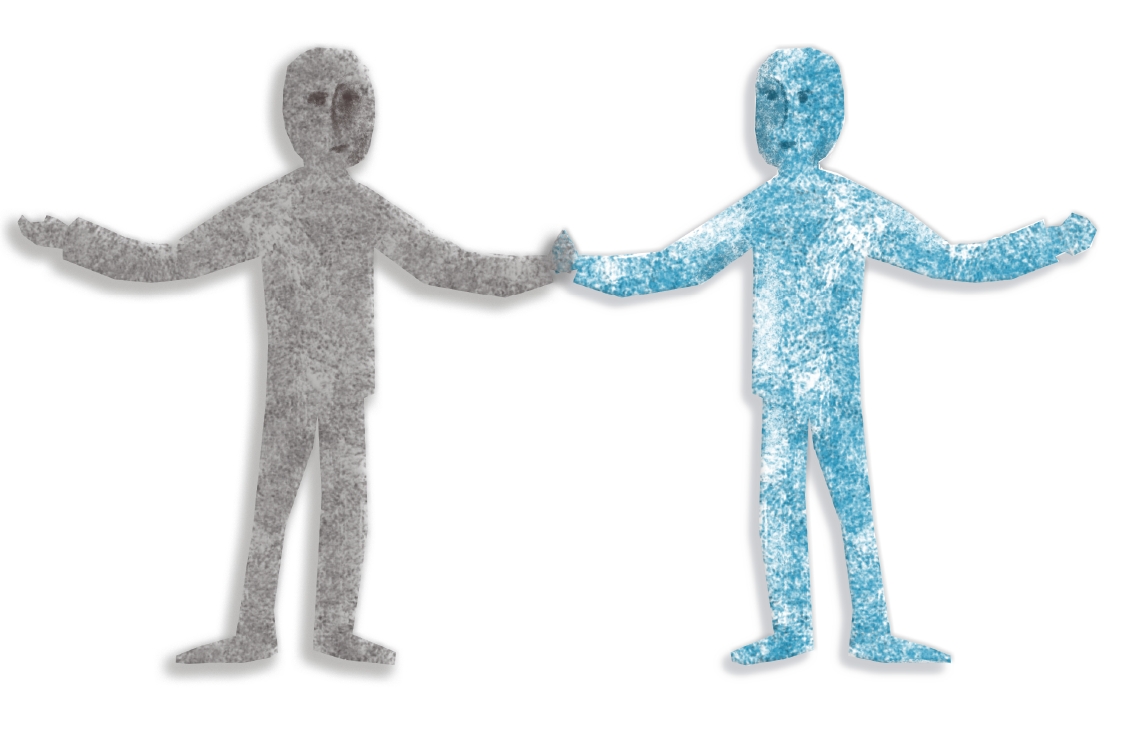 Will man zu einem wirklichen Wandel im ärztlichen Gesprächsverhalten beitragen, gilt es, an der ärztlichen Handlungspraxis selbst anzusetzen und deren jeweiligen kontextgebundenen Herausforderungen zu berücksichtigen. Es müssen zuallererst die fachlichen Ansprüche ernst- und aufgenommen werden, und es gilt aufzuzeigen, ob und wie diese durch bestimmte Interaktionsmuster eher erreicht oder im Gegenteil verfehlt werden und welche Grundhaltungen hierbei förderlich bzw. eher hinderlich sind (vgl. Somm et al. 2018).
Will man zu einem wirklichen Wandel im ärztlichen Gesprächsverhalten beitragen, gilt es, an der ärztlichen Handlungspraxis selbst anzusetzen und deren jeweiligen kontextgebundenen Herausforderungen zu berücksichtigen. Es müssen zuallererst die fachlichen Ansprüche ernst- und aufgenommen werden, und es gilt aufzuzeigen, ob und wie diese durch bestimmte Interaktionsmuster eher erreicht oder im Gegenteil verfehlt werden und welche Grundhaltungen hierbei förderlich bzw. eher hinderlich sind (vgl. Somm et al. 2018).
Ein weiterer Bereich, wo Handlungsforschung in der Medizin dringlich ist, betrifft die Anwendung evidenzbasierten Wissens in der ärztlichen Praxis. Gesundheitspolitisch beklagt wird nämlich nicht selten die mangelnde Leitlinientreue ärztlichen Handelns. Warum dies so ist, darüber weiß man wenig. Stattdessen konzentrieren sich die Anstrengungen darauf, Leitlinientreue zu forcieren, indem Unmengen an Behandlungsleitfäden, Checklisten und Screeningbögen entwickelt werden. Übersehen wird hier, dass eine solche Schematisierung nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass sich das reale Patient*innenklientel nicht einfach dem Standardfall von Doppelblindstudien fügt. Vielmehr bleibt immer eine „unaufhebbare Differenz von interner und externer Evidenz“ (Behrens 2003) bestehen und muss seitens der Ärzt*innen bewältigt werden. Diese fallbezogene Interpretation von Leitlinien kann die Handlungsforschung untersuchen und daraus Schlüsse ziehen für die Professionalisierung der ärztlichen Urteilskraft in Aus- und Weiterbildung.
